Speichertechnologien von Übermorgen

Schneller, kleiner, smarter: Internetfähige Geräte sind allgegenwärtig. Was heute ein Smartphone leistet, konnte vor wenigen Jahren nur ein großer Computer. Gleichzeitig wachsen der Stromverbrauch und der weltweite Datenverkehr für Streaming, Clouddienste, künstliche Intelligenz und das ständige Online-Sein stetig. Aktuelle Technologien kommen bei der Speicherkapazität, Rechengeschwindigkeit und Energieeffizienz mittelfristig an ihre Grenzen. Forschende am Institut für Physik der Martin-Luther-Universität arbeiten an Lösungen für diese großen Herausforderungen.
„Wir wollen uns neben der elektrischen Ladung weitere Eigenschaften von Elektronen zunutze machen: Ein wichtiges Beispiel dafür ist der Spin“, sagt der Physiker Prof. Dr. Georg Woltersdorf. Beim Spin handelt es sich um den quantenmechanischen Eigendrehimpuls, der Elektronen zu magnetischen Objekten macht. Die Grundidee klingt zunächst einfach: In elektronischen Geräten und Bauteilen soll künftig neben der elektrischen Ladung auch der Spin genutzt werden, um zum Beispiel Informationen zu übertragen. Im Vergleich zu bereits existierender Technologie könnte die Informationsverarbeitung deutlich schneller und gleichzeitig energieeffizienter sein. Denn im Gegensatz zum Transport elektrischer Ladung kann beim Transport von Spinströmen Wärmeentstehung weitgehend vermieden werden.
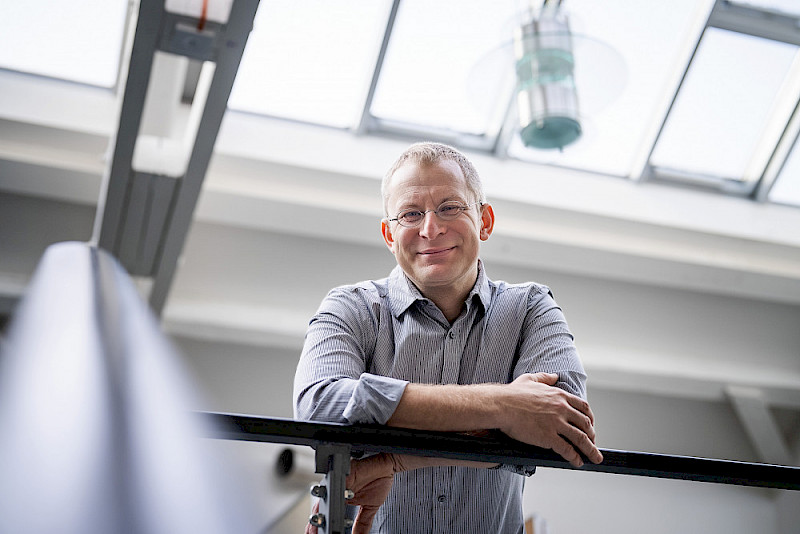
Die Forschung im Bereich der Spin- und Nanoelektronik ist aber alles andere als trivial. Um die zugrunde liegenden Effekte im Detail zu verstehen und später einmal auszunutzen, müssen maßgeschneiderte Materialien auf der Nanoebene gestaltet und untersucht werden. Dafür sind extrem präzise wie auch zeitaufwändige Experimente, Simulationen und neue Theorien nötig.
Spannend wird es auch, wenn man etwa die Spinelektronik mit weiteren Ansätzen für neuartige Elektronik verbindet. Genau das geschieht in Halle: Zum Beispiel kombinieren die Forschenden die Spinelektronik mit der Supraleitung, bei der Strom ohne Widerstand fließt. Hier und bei vielen weiteren Aspekten der Spin- und Nanoelektronik spielt Chiralität eine zentrale Rolle. Chiralität bezeichnet die Eigenschaft eines Objekts, sich von seinem Spiegelbild zu unterscheiden. Ein Beispiel dafür sind die menschlichen Hände: Linke und rechte Hand gleichen sich, sind aber nicht identisch. Chiralität ist ein zentrales Prinzip in der Natur bis zur Ebene der Elementarteilchen und kann Objekten eine intrinsische Stabilität und viele andere Eigenschaften verleihen.
„Wir betreiben Grundlagenforschung im Nanobereich mit dem Ziel, neue Potenziale für Anwendungen in der Elektronik zu schaffen. Zum Beispiel die Verbindung von Spinelektronik und Supraleitung durch Chiralität birgt hierfür ein enormes Potenzial“, sagt Woltersdorf, der seit vielen Jahren zu diesen Themen forscht. Wie vielversprechend dieses ambitionierte Forschungsprogramm ist, zeigt ein großer Erfolg aus der jüngeren Vergangenheit: Gemeinsam mit der Freien Universität Berlin, der Universität Regensburg und dem Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik (MPI) hat es die MLU ins Finale der Exzellenzstrategie geschafft. Die vier Einrichtungen haben sich mit dem „Center for Chiral Electronics“ beworben. Im Erfolgsfall erhält das Cluster ab 2026 über sieben Jahre bis zu 70 Millionen Euro.
Georg Woltersdorf stellte mit Forschenden aus Halle, Berlin und Regensburg den Antrag für das „Center for Chiral Electronics“. Dass es der MLU mit ihrem mit 15 Professuren vergleichsweise kleinen Physikinstitut gelungen ist, im Bereich der Festkörperphysik international in der ersten Liga mitzuspielen, ist kein Zufall. Die Forschung der Physikerinnen und Physiker ist in den universitären Forschungsschwerpunkt „Materialwissenschaften – Nanostrukturierte Materialien“ eingebettet, der sich mit der Entwicklung neuartiger Materialien und innovativer Messmethoden befasst.

Dieser Bereich hat an der MLU eine lange Tradition: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert hier Arbeiten auf diesem Gebiet seit 1996 regelmäßig über Sonderforschungsbereiche oder Forschungsgruppen. Anfang der 2000er Jahre ergab sich zudem die Möglichkeit, das Institut für Physik inhaltlich weiter zu profilieren, da mehrere Professuren in kurzer Zeit frei wurden. Hier wurde der Schwerpunkt zu Spin- und Nanoelektronik, neben der Polymerphysik, konsequent gestärkt.
Ein weiterer Vorteil: Häufig arbeiten heute verschiedene Gruppen gemeinsam an Forschungsgeräten. Dazu gehören zum Beispiel der MLU-eigene Reinraum, Optiklabore mit Lasersystemen für Spektroskopie, Labore mit Kryostaten für Transportmessung sowie Vakuumsysteme zur Synthese komplexer Materialien und Schichtsysteme. Das alles stärkt den wissenschaftlichen Austausch und befruchtet die Zusammenarbeit, was sich auch in gemeinsam erfolgreich eingeworbenen Projekten niederschlägt. Dank dieser Kooperationen, der strategischen Berufungen und internationalen Forschungspartnerschaften hat sich das Institut in den vergangenen Jahren eine beachtliche Bilanz erarbeitet. Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen die Physikerinnen und Physiker regelmäßig in angesehenen Fachjournalen, wie „Science“, „Nature Physics“, „Physical Review Letters“ oder „Nature Communications“. Zu den zahlreichen DFG-Projekten kommen hochkarätige EU- und Bundesförderungen hinzu. Dazu gehören mehrere der begehrten „ERC Grants“ des Europäischen Forschungsrats ERC, die jeweils mit einer Millionenförderung verbunden sind.
Ein besonderer Coup gelang der MLU mit dem MPI für Mikrostrukturphysik im Jahr 2013: Gemeinsam nominierten die beiden Einrichtungen Prof. Dr. Stuart Parkin, den Erfinder der modernen Festplattentechnologie, erfolgreich für eine Alexander von Humboldt-Professur, Deutschlands höchstdotiertem internationalen Forschungspreis. Der Wissenschaftler hat mehr als 120 Patente angemeldet und gehört laut dem Unternehmen „Clarivate“ zu den 0,01 Prozent der meistzitierten Forscher weltweit. Anfang 2024 wurde Parkin mit dem mit 500 000 US-Dollar dotierten Charles-Stark-Draper-Preis der National Academy of Engineering in den USA gewürdigt. Damit steht ein Wissenschaftler der MLU und des MPI in einer Reihe mit den Erfindern des World Wide Web, der GPS-Technologie oder der Lithium-Ionen-Batterie.
Wie eng und fruchtbar die Verbindung der MLU zu dem forschungsstarken Max-Planck-Institut ist, zeigt auch ein Blick auf die „Max-Planck-Fellowships“. Mit dem Programm fördert die Max-Planck-Gesellschaft die Kooperationen ihrer Institute mit herausragenden Forscherinnen und Forschern an Universitäten. Die Fellows erhalten für zunächst fünf Jahre eine Förderung über 500 000 Euro, eine einmalige Verlängerung ist möglich. Vom Institut für Physik wurden seit 2007 drei Forschende in das Programm berufen: Prof. Dr. Ingrid Mertig, Prof. Dr. Wolf Widdra und seit 2020 Prof. Dr. Georg Woltersdorf.
Auch international hat sich das Physikinstitut der MLU zu einer gefragten Adresse für Forschende aus aller Welt entwickelt. Immer wieder gelingt es, etwa mit Unterstützung der Alexander von Humboldt- Stiftung, hochkarätige Forscher nach Halle zu holen: 2015 war der Physik-Nobelpreisträger Prof. Dr. Albert Fert für mehrere Forschungsaufenthalte an der MLU zu Gast.
Diese Erfolgsgeschichte wollen die Forschenden am Institut für Physik fortsetzen und auch daran arbeiten, dass ihre Erkenntnisse in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Eingang in die Praxis finden. Und wer weiß: Vielleicht steckt in einigen Jahren in den neuesten Festplatten und Computerchips auch ein Stück hallescher Forschungsgeschichte.
