Universitätsgeschichte: Die Suche nach dem Masterplan
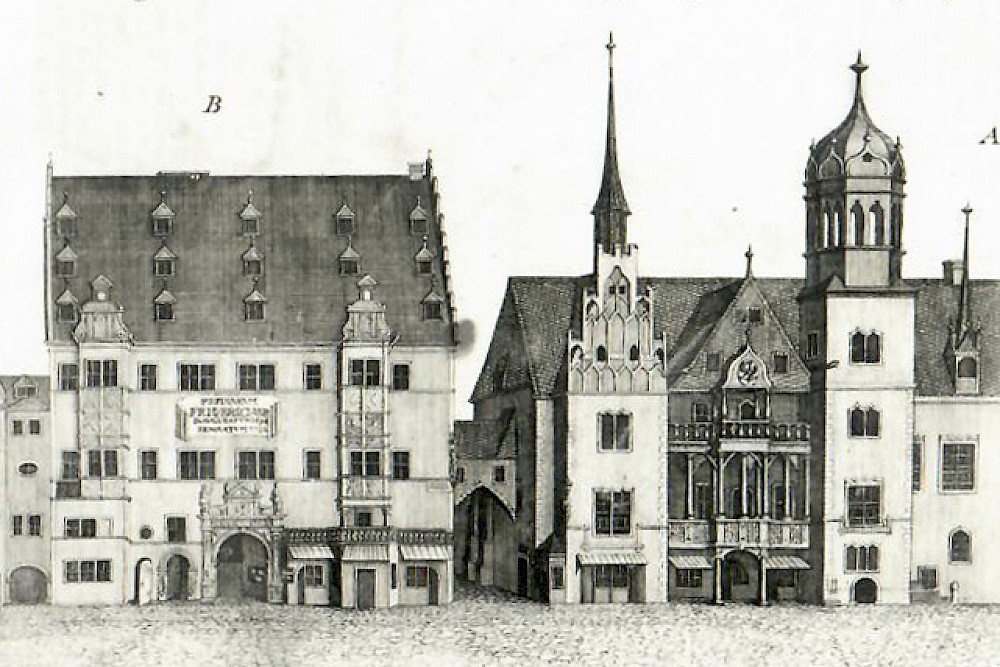
In der Beschreibung Ihres Buches heißt es, dass Sie die „Meistererzählung“ von der Uni Halle prüfen. In dieser gängigen Geschichtsdarstellung ist sie eine der drei Universitäten, deren Gründungen als Meilensteine für die Entstehung der modernen Forschungsuniversität in Deutschland gelten. Warum muss das auf den Prüfstand?
Andreas Pečar: In der Meistererzählung zur Universität wird unterstellt, dass sie planmäßig errichtet worden sei – anders als alle anderen, die bis dahin im Reich existierten, und neu im Sinne eines Profils und der Struktur. Unterstellt wird zudem, dass Christian Thomasius als einer der Gründer gewissermaßen der Spiritus Rector in Halle war und alle Kollegen einträchtig gefolgt sind.
Um es vorwegzunehmen: Unsere Arbeit ist keine klassische Gelehrtengeschichte. Es gab sicher einige neue Ideen, die von manchen Gelehrten in Halle entwickelt wurden. Das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Wir wollen aber in Abrede stellen, dass das Teil eines politischen Masterplans war. Dafür haben wir insbesondere die Kommunikation zwischen Berlin und Halle untersucht.
Trotzdem noch einmal: Warum kamen Zweifel am Masterplan auf?
Pečar: Die sind bereits Gegenstand mehrerer Publikationen von Altrektor Prof. Dr. Udo Sträter. Auch er hat gesagt, dass er so einen Masterplan auf politischer Ebene nicht finden kann. Wir greifen also neuere Forschungen auf. Das Gleiche gilt für Thomasius. Auch da gibt es bereits Aufsätze, die ein bisschen zweifeln, ob er in allen Punkten der Vorreiter war. Uns hat interessiert: Ist Thomasius auf institutioneller Ebene eine Art Leitwolf an der Universität Halle?
Ist er es?
Pečar: Überhaupt nicht. Von Anfang an mosert er herum, schreibt Briefe nach Berlin, dass er sich fürchterliche Sorgen macht und die Universität völlig ruiniert wird, wenn man nicht endlich auf ihn hört. In der Universitäts-Geschichte von Historiker Notker Hammerstein heißt es aber, die Universität erlebe eine großartige Konjunktur – wegen Thomasius. Diese Diskrepanz hat uns doch überrascht. Übrigens: In dem Moment, als Thomasius institutionell tatsächlich als Professor eine Führungsposition bekommt – er wird 1710 als Nachfolger von Samuel Stryk zum Direktor ernannt und versucht, im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger aus dieser Position eine Führungsrolle in der Universität neben dem Prorektor abzuleiten -, läuft die gesamte Universität gegen ihn Sturm. Unter dem neuen König Friedrich Wilhelm steht er sogar kurz vor dem Rausschmiss und fortan, ab 1713, mischt er sich in Universitätsdebatten nicht mehr wirklich ein.
Wie lief die Kommunikation zwischen der Uni und dem Berliner Hof und wie häufig war sie?
Marianne Taatz-Jacobi: Beeindruckend ist die Mehrdimensionalität der Kommunikationsprozesse. Man hat im Prinzip nie ein nur einen Kontakt zwischen Halle und Berlin, sondern es gibt eine Vielzahl von Akteuren: den Hof, die Hofgesellschaft und die Regierungsinstitutionen, Institutionen auf Landesebene im Herzogtum Magdeburg, die Stadt, die Garnison – und die Universität. Die Intensität der Kommunikation unterscheidet sich je nach Fakultät. In Hochphasen von Konflikten wird alle zwei Tage geschrieben – zum Beispiel zwischen August Hermann Francke und König Friedrich Wilhelm.
Sie schreiben, die Profilbildung an der Uni sei nicht selten eher dem Zufall geschuldet als einem ausgewiesenen Plan. Woran zeigt sich das für Sie?
Pečar: Die Begriffe Aufklärung und Pietismus, mit denen die Universität beschrieben wird, sind nicht an den Haaren herbeigezogen. Es gibt Schwerpunktthemen, die in Halle besonders gelehrt werden. Wenn wir sagen „dem Zufall geschuldet“, meinen wir, dass das passiert, weil es eben im Interessenhorizont bestimmter Gelehrter liegt, die in Halle sind. Es ist nicht Folge von Governance, man hat sie nicht geholt, weil sie so lehren, sondern aus anderen Gründen. Thomasius zum Beispiel bekommt die Professur, weil er sich für den Kurfürsten von Brandenburg ausgesprochen und mit seinem eigentlichen Dienstherrn, dem Kurfürsten von Sachsen, Ärger bekommen hat. Man war ihm also etwas schuldig. Diesen Unterschied, den wollen wir betonen. Das heißt aber nicht, dass Halle kein inhaltliches Profil hatte. Es ist nur nicht die Folge einer Planung, weder auf der Ebene Berlin noch auf universitärer Ebene.
Unterscheiden sich die Stile der beiden Monarchen in Bezug auf die Universität?
Pečar: Man kann eine Verschiebung feststellen, die mit den beiden Herrschern korrespondiert. Die rationalere Wissenschaftspolitik in dem Sinne, dass man Amtsträger ernennt und die weitgehend entscheiden, findet man bei Friedrich I. Sein Nachfolger König Friedrich Wilhelm I. reißt in Einzelfällen Belange an sich und entscheidet auf eigene Faust, ohne seine Amtspersonen überhaupt noch zu befragen. Das weiß man in Halle auch – und wir können sehen, wie in manchen Konstellationen ein König fremdbestimmt wird durch Gelehrte an der Universität. Das berühmteste Beispiel ist sicher die Vertreibung von Christian Wolff. Diese Entscheidung trifft der König spontan nach einem Briefwechsel mit August Hermann Francke. Solche spontanen, schwer rationalisierbaren Entscheidungen gibt es mehrfach, nicht immer nur auf Intervention aus Halle. Da wird ein neuer Lehrstuhl für Kameralistik eingerichtet, der interessiert den König aber bestenfalls drei Jahre. Dann wird ein Juraprofessor aus Frankfurt/Oder nach Halle geholt und ein anderer von Halle nach Frankfurt geschickt, obwohl eigentlich alle dagegen protestieren.
Das spricht nicht für eine ausgefeilte Agenda…
Pečar: So ist es. Eine allgemeine Agenda gibt es zwar, aber sie ist sehr unkonkret: Man will natürlich eine blühende Universität, die keine negativen Schlagzeilen macht. Und eine Universität blüht, wenn viele Leute dort studieren - das Exzellenzkriterium schlechthin sind die Einschreibezahlen - und wenn unter diesen Studenten möglichst viele Adlige sind.
Taatz-Jacobi: Wenn es um die Zeit um 1730 geht, ist in der Literatur immer wieder gesagt worden, die Universität sei in eine Krise geraten, und zwar eine Krise betreffend der Exzellenz ihres Lehrkörpers und ihrer Lehre. Bei genauerer Untersuchung der Kommunikationsprozesse kann man aber feststellen, dass zwar die Qualität des Lehrkörpers immer mal argumentativ angeführt wird. Bei den Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, ist die Frage, wer in Halle lehrt, aber nicht der Hauptaspekt.
Pečar: Bei Friedrich Wilhelm I. kommt noch ein zweiter Punkt dazu, der sein wichtigstes Politikfeld betrifft: der Aufbau einer großen Armee. In Halle kommt man in die Bredouille, weil regelmäßig Studenten in die Armee gebracht werden. Dabei gibt es eine Vielzahl von Edikten, in denen diese Art von Zwangswerbung ausdrücklich verboten wird. Sie sind aber das Papier nicht wert, auf dem sie stehen, weil sich der König in seiner Handlungsfreiheit nicht binden lässt. Die Universität wird also immer wieder zum Bittsteller und begibt sich in einen typisch höfischen Mechanismus. Auf der einen Seite steht Leopold von Anhalt-Dessau, der die Soldaten in die Armee gebracht hat und eine der einflussreichsten und persönlich dem König am nächsten stehenden Personen ist, auf der anderen die Universität. Wer das Duell gewinnt, kann man sich ausmalen.
Also entscheidet der persönliche Kontakt am Hof?
Pečar: Man kann an diesem Problem sehr gut sehen, das auch die Kommunikation mit der Universität nach höfischen Mechanismen abläuft. Beim Thema Soldatenwerbung fällt sie zum Nachteil der Universität aus. Bei Konflikten, die die Universität innerhalb der Stadt Halle hat, profitiert die Universität massiv, weil die Vertreter der Stadt in Berlin noch viel schlechtere Kontakte haben als die Gelehrten.
Sie betten das Buch auch in heutige Debatten über Governance, Profilbildung und Exzellenz ein. Wie kann der Blick zurück da helfen?
Pečar: Der Vergleich mit der Geschichte kann das Nachdenken darüber anregen, ob die Steuerung heute wirklich rationaler und von mehr Erfolg gekrönt ist. Das Buch durchzieht ein ausgesprochen skeptischer Ansatz gegenüber Erfolgschancen von Governance. Was die Halbwertzeit von Governance-Ideen der politischen Ebene betrifft, sind wir heute glaube ich nicht viel besser als Friedrich Wilhelm I. Zumindest stellt sich die Frage, ob sich etwas anderes empirisch nachweisen lässt.
Zum Buch
Marianne Taatz-Jacobi, Andreas Pečar: Die Universität Halle und der Berliner Hof (1691–1740). Eine höfisch-akademische Beziehungsgeschichte, Stuttgart 2021, 351 Seiten, 68 Euro, ISBN 978-3-515-12910-7
Das Buch ist Ergebnis eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit rund 250.000 Euro geförderten Projekts.


